Recherchen
Die Entwicklung der Harmoniuminstrumente
Orgue-Expressif, Aeoline und Seraphin
Der Beginn der Harmoniumgeschichte liegt zwischen 1790 und 1825. Also in der Zeit, als das Cembalo endgültig vom Pianoforte abgelöst wurde und wegen seiner größeren Ausdrucksfähigkeit besser der damaligen musikalischen Praxis entsprach. An verschiedenen Orten arbeiteten Musiker wie Instrumentenmacher daran, die Ausdrucksfähigkeit und die Expressivität (im wesentlichen stufenlose Dynamik) der Orgel zu steigern .
Erinnert sei an die Orgelreform von Abbé Vogler, der u.a. in Petersburg die durchschlagende Zunge entdeckte und in die Orgel einbaute.
In Frankreich fertigte Gabriel-Joseph Grenié (1757-1837) seine Orgue-Expressif, die er 1810 in Paris ausstellte. Diese kleine Orgel hatte nur ein Zungenregister mit durchschlagenden Zungen und vollem Becher. Der Spieler produzierte den Wind mittels zweier Doppelschöpfer selbst. Der Magazinbalg ist nur sehr klein. Der Spieler kann bei geschickter Pedaltechnik mit größerem oder kleinerem Winddruck spielen. Die durchschlagenden Zungen behalten weitgehend ihre Stimmung, aber die Lautstärke differiert je nach Winddruck.
In Deutschland werden ebenfalls Erfindungen gemacht, die unter Namen wie Aeoline, Aelodikon o.ä. vorgestellt werden. Den zeitgenössischen Berichten nach benutzten diese Instrumente zwar schon durchschlagende Zungen, hatten aber immer noch einen permanent wirkenden Magazinbalg.
In England wurde die Erfindung des Seraphin populär. Dieses Instrument hatte einen Schöpfbalg und einen Magazinbalg. Die Exressivität wurde durch einen Deckelschweller und einen Eingriff in das Ventilspiel erreicht. Eine weitere Möglichkeit, dieses Instrument expressiv zu benutzen, bestand darin, den Schöpfbalg auf einer Phrase mit unterschiedlichem Druck zu behandeln, ohne daß der Magazinbalg in Aktion trat. Für dieses Instrument sind fünf Original-Kompositionen von Samuel Wesley (1766-1837) überliefert.
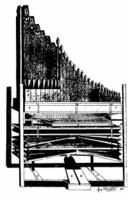

Die Wiener Physharmonika
In den meisten Publikationen wird als Erfinder Anton Haeckel und die Jahreszahl 1821 angegeben, als Beleg wird ein Instrument des Leipziger-Musikinstrumentenmuseums abgebildet. Dieses Instrument verfügt über einen Schöpfer und einen Magazinbalg, hat aber keine Einrichtung für ein expressives Spiel.
1833 erscheint bei Anton Diabelli in Wien eine erste Physharmonikaschule von Carl Georg Lickl: "Theoretisch Practische Anleitung zur Kenntniss und Behandlung der Phys-Harmonika". Er beschreibt ein Instrument mit sechs Oktaven (Contra F bis f4), durchschlagenden Zungen und zwei Schöpfbälgen. Auf einen Magazinbalg wurde verzichtet, da dieser keinen Sinn für das expressive Spiel macht. Lickl beschreibt es so:
"[...] Auch gibt es geringere Arten von Physharmoniken, die an Tonumfang viel kleiner sind, statt zwei Druckbälgen nur einen einfachen Schöpf- oder Blasebalg haben. Da man auf denselben ausser Stande ist, den Ton modulieren, noch sonst etwas ausführliches hervorbringen zu können, und diese Art in Ausübung der angeschlossenen Stücke beschränkt ist, so schliesst man sie als zu dieser Anleitung nicht gehörig aus, und begnügt sich bloss auf ihre Existenz hinzudeuten. [...]"
Gemeint ist hier wohl die Physharmonika von Anton Haeckel. Lickl nennt auch den Namen seines Instrumentenbauers:
"[...] Diese [gemeint ist ein Instrument mit einem zusätzlichem 4'] so wie die erstere besprochene Art der Physharmonika, für welche nur einzig allein diese Anleitung geschrieben wurde, verfertigt Herr Jacob Deutschmann bürgerlicher Orgelbauer und Instrumenten-Macher (in der Lumpertgasse No. 821), sie zeichnen sich durch vorzüglich schönen Ton, schnelle Ansprache, haltbare Stimmung und elegante Bauart aus.[...]"
Ein entsprechendes Instrument befindet sich ebenfalls im Musikinstrumenten-Museum in Leipzig, und ebenso ein baugleiches des Franzosen Achille Müller, das aus dem Besitz des Komponisten Sigismund Neukomm stammt. Die älteste Originalkomposition von Neukomm für diese Physharmonika stammt von 1826. Daraus läßt sich schließen, daß Deutschmann seine Physharmonikas schon vor 1826 angefertigt hat und andererseits, daß auch zwischen den Regionen und Nationen ein Austausch über diese Erfindungen stattgefunden haben kann.


Das französiche Harmonium
1842 erwirkt Francois Debain ein Patent für ein genau definiertes Instrument mit dem Namen 'Harmonium'. Damit ist auch der Name in Frankreich geschützt, und andere Hersteller nennen ihre Harmoniums "Orgue Expressif", "Orgue Alexandre", "Orgue Mustel", "Orgue Mélodium" etc. Die Patentschrift entspricht genau dem 'klassischen französischen Vierspiel'. (Dieses Instrument wird weiter unten genauer beschrieben.)
1853 gründet Victor Mustel seine eigene Firma. Er meldet die Erfindung der geteilten Expression zum Patent an. In den folgenden Jahren bildet sich bei Mustel durch weitere Erfindungen um 1890 der Instrumententyp 'Kunstharmonium' heraus. (Weiteres dazu in einem eigenem Kapitel.)
Das deutsche Druckwindharmonium
Die Hersteller Philip Trayser und J. & P. Schiedmayer gründen um 1850 in Stuttgart Harmonium-Fabriken. Die Firmengründer haben ihr Handwerk jeweils in Frankreich gelernt und führen somit das französische Druckwindharmonium in Deutschland ein.
(Literaturempfehlung: Das Harmonium in Deutschland, Hrsg. Christian Ahrens)
Das amerikanische Saugwindharmonium
Die Frühgeschichte des Harmoniums in Amerika ist genau so abwechslungsreich und spannend wie die europäische Geschichte. Die Bedeutung des amerikanischen Beitrages liegt in der industriellen Fertigung von Harmoniums mit Saugwindsystem. Dies begann in den 1850er und 1860er Jahren durch die großen Firmen 'Estey' und 'Mason & Hamlin'. Bis zur Jahrhundertwende bildet sich bei diesen beiden Firmen eine Standard-Disposition und ein Standard für Umfang und Registerteilung heraus.
(Literaturempfehlung: The American Reed Organ, Robert F. Gellermann)
Das deutsche Saugwindharmonium und Normalharmonium
Um 1890 wurden in Deutschland viele amerikanische Saugwindharmoniums importiert, meistens zur Verwendung als Orgelersatzinstrument. Die deutschen Hersteller von Druckwindharmoniums bauten auch schon expressionslose Instrumente zur Verwendung als Orgelersatz, aber Saugwindinstrumente waren wohl preiswerter herstellbar, so daß auch sie sich mit den Möglichkeit der Herstellung von Saugwindinstrumenten vertraut machen mußten.
Besonders die Firmengründer in Sachsen wie 'Mannborg', 'Lindholm' u.a. führten das neue Saugwindsystem ein. Die süddeutschen Harmoniumbauer nahmen nun auch die Produktion von Saugwindharmoniums in ihr Fertigungsprogramm auf.
Unter dem Vorsitz von Theodor Mannborg beschloß 1903 der "Verein der Harmoniumfabrikanten" eine 'einheitliche Disposition', und jedes Mitglied sollte, wenn möglich, mindestens ein Instrument mit dieser Disposition anbieten. Dieses Instrument wurde 'Normalharmonium' genannt. Hatte das Instrument mehr Register, wurde es 'erweitertes Normalharmonium' genannt.
In den 1920er Jahren versuchten einige Hersteller, neue Namen für größere Saugwind-Instrumente einzuführen wie: 'Resonanz-Kunstharmonium', 'Saugwind-Kunstharmonium'. In den 1930er Jahren bauten die meisten nur noch Instrumente für die Verwendung als Orgelersatz, die Firma Lindholm zum Beispiel ein zweimanualiges Instrument mit Pedal und steiler Disposition als Übeinstrument für orgelbewegte Organisten.
(Literaturempfehlung: Das Harmonium in Deutschland, Hrsg. Christian Ahrens)
Weitererführende Literatur
Weitere Titel finden Sie auf der Seite "Standard-Literatur zum Harmonium"
Christian AHRENS (Hrsg.) und Gregor KLINKE (Hrsg.):
Das Harmonium in Deutschland: Bau, wirtschaftliche Bedeutung und musikalische Nutzung eines "historischen" Musikinstrumentes.
Frankfurt/Main: Bochinsky, 1996;
2. erweiterte Auflage 2001.
(Fachbuchreihe "Das Musikinstrument"; Bd. 60).
320 Seiten, zahlreiche Illustrationen, 8-seitiger Fotoanhang.
ISBN 3-923639-48-1
Robert F. GELLERMAN:
The American Reed Organ and The Harmonium.
New York: Vestal Press, 1996
ISBN 1-879511-07-X
Robert F. GELLERMAN:
Gellerman's International Reed Organ Atlas. Second Edition.
Lanham, Maryland: Vestal Press , 1998
ISBN 1-879511-34-7
H. F. MILNE:
The Reed Organ: Its Design and Construction.
London: Musical Opinion, 1930.
Reprint: Braintree Mass.:The Organ Literature Foundation, o. J.
ISBN 0-913746-02-9

